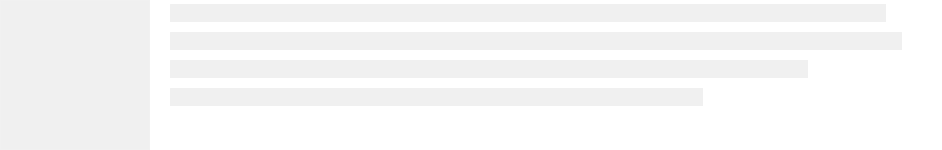Gesprächsstoff: Kuba Dabrowski
„Polen wurde noch nicht oft genug fotografiert“
April 27, 2022


Polen braucht einen Bruce Springsteen. Wenn Kuba Dabrowski von seinem Zuhause spricht, ein kleiner Wohnblock im Osten Polens, keine 40 Kilometer von der belarussischen Grenze entfernt, dann scheint fortwährend ein Kampf in ihm zu ringen: der Osten gegen den Westen. Viele Jahre hat für den jugendlichen Dabrowski der Westen über den Osten gesiegt. Sein Sehnsuchtsort Nummer eins: Amerika. Er skatete und trug weite Baggy Pants, hörte amerikanischen Rap, warf nach der Schule Körbe. An seiner Zimmerwand hingen NBA-Stars wie Michael Jordan und Scottie Pippen. Seine Freunde sahen aus wie einem MTV-Musikvideo entsprungen und fühlten sich auch so. Sie bauten sich in ihrem polnischen Wohnblock und in ihrer Fantasie ein „little America“.


Bis Kuba seinen Sehnsuchtsort Amerika mit Ende 20 endlich besuchte. Er war enttäuscht. „Die Bilder sind manchmal interessanter als die Geschichte dahinter“, sagt Kuba Dabrowski heute, über zehn Jahre später in einem Café in Berlin-Mitte. Dabrowski war den Erzählungen der Filme, Musikzeilen und Büchern gefolgt, wie in den Songs von Bruce Springsteen, der Romantisierung der breiten einsamen Straßen, der Freiheit, dem Versprechen, das alles möglich ist. Heute ist er es, der Geschichten mit Bildern erzählt – Kuba Dabrowski ist Fotograf.

Dabrowski ist bekannt für seine Bilder von Größen wie Anna Wintour auf der Fashion Week in ihren extravaganten Outfits, aber auch genauso von Normalos auf der Straße in noch interessanteren Outfits, für seine Bilder, die den Alltag ablichten von Menschen in Ländern wie Afghanistan, aber auch seinem eigenen Alltag, seiner Frau, seinem Sohn, seinem Leben in Berlin. Es ist schwer, Dabrowski in eine Nische zu packen und im Gespräch wird klar: Eine Nische wäre seine größte Angst. Dabrowski arbeitet für Magazine wie die Vogue, WWD und auch für Achtung. Und auch wenn Dabrowski sich wohl selbst nie so nennen würde, viele seiner Arbeiten sind die Werke eines Street-Style-Fotografen. Würde es eine vorgeschriebene Körpergröße, ein Mindestmaß an Unsichtbarkeit, ein Sollwert für Höflichkeit in der Berufsbeschreibung eines Street-Style-Fotografen geben; Dabrowski würde sie alle erfüllen. Er ist gerade so groß, dass er alle Menschen in der Schlange im Café überragt, ohne zu groß zu wirken. Eine Perspektive, aus der sich hervorragend interessante Menschen auf der Straße erspähen lassen, noch bevor sie entweder einen selbst entdecken oder man in sie hineinstolpert. Seine Art ist gerade zurückhaltend genug, um überzeugend, ohne jedoch aufdringlich zu sein. Das muss sein, wenn man fremde Menschen auf der Straße fotografieren will. Sein Werkzeug hängt um seinen Hals: eine digitale Kamera – silber-schwarz, klein, handlich, unauffällig.


Bevor Kuba Dabrowski auch nur ein einziges Foto mit so einer Kamera schoss, wusste er bereits genau, wie sie funktionierte. Kuba wuchs in einer Ingenieursfamilie auf; seine Eltern wollten, dass er verstand, wie Dinge funktionieren – aus technischer Sicht. Aber das richtige Fotografieren begann mit einer Plastiktüte, die sein Opa in sein Leben brachte. Inhalt: 150 abgelaufene Schwarz-Weiß-Filme. Damals war Dabrowski gerade 14 Jahre alt. Sein Opa hatte ihm die Filme mitgebracht, nachdem er mal wieder von einem seiner Streifzüge in die Vergangenheit zurückkam. Wenn Kuba von seiner Kindheit und den Anfängen seiner Fotografie erzählt, wirkt es fast so, als würde er gedanklich in einem Archiv verschwinden. Als müsse er die Ereignisse katalogisieren, bevor er sie aussprechen kann. Manchmal verfranzt er sich und setzt neu an. Seine Sätze beginnen dann mit einem tiefen Seufzer und einem „Ok.“ Als müsse er sich selbst erst davon überzeugen, dass seine Vergangenheit so viel mit seiner Gegenwart zu tun hat, dass sie es überhaupt wert ist, erzählt zu werden.
Kubas Großvater ist in der Gegend von Vawkavysk, einer Stadt im heutigen Belarus aufgewachsen und während des zweiten Weltkriegs nach Polen geflohen. Nachdem ihre Heimatstadt Teil der Weißrussischen Sozialistischen Sowjetrepublik wurde, haben er und seine Frau sich entschieden, nicht zurückzukehren und ein neues Leben in Polen zu beginnen. Den heimatlichen lokalen Dialekt, die Menschen vor Ort, erzählt Kuba Dabrowski, all das habe sein Opa nie vergessen und immer vermisst.


Als dann nach dem Zerfall der Sowjetunion 1989 wieder eine Beziehung zwischen Polen und Belarus möglich war, kamen auch die Menschen wieder über die Grenze. Am polnischen Grenzort, in der Nähe von Dabrowskis Heimatviertel, breiteten Menschen aus Belarus Decken auf dem Boden aus oder öffneten ihre Kofferräume und verkauften allerlei Waren. Dabrowskis Opa habe es geliebt, auf diesen provisorischen Märkten endlich wieder Kontakt zum Heimatland zu haben: „Aber an diesen Orten muss man was kaufen, du kannst da nicht einfach nur rumhängen. Also kam er immer mit sehr seltsamen Sachen nach Hause. Dinge, die wir nie brauchten.“ Doch einmal brachte er 150 Schwarz-Weiß-Filme und – was er damals nicht wissen konnte – auch die berufliche Zukunft seines Enkels in einer großen Plastiktüte mit nach Hause.

Das Besondere war, dass Dabrowski somit damals schon tun konnte, was Leute heute mit ihren Handys machen: unbegrenzt, gedankenlos Fotos aufnehmen. In einer Zeit, in der Filme teuer waren und jedes Foto gut überlegt sein musste, konnte er willkürlich knipsen. Also hat er angefangen, alles zu fotografieren – wie seine Freunde Basketball spielten, den Bildschirm seines Fernsehers, auf dem MTV-Musikvideos liefen, das Chaos in seinem Zimmer.



Vielleicht waren diese 150 Filme und die Unbekümmertheit, die sie mit sich brachten, der Beginn eines Grundsatzes für Kubas Arbeit, der noch heute gilt: Er denkt nicht in einzelnen Bildern, in perfekt inszenierten oder gut überlegten Momenten und Szenen. Bilder funktionieren für ihn in einer Reihe. Sollen sie eine Geschichte erzählen, können sie nicht für sich allein stehen.


Doch was von seinem Opa so schön unbewusst als Grundstein für seine Karriere gelegt wurde, sollte einige Jahre später kurz vorm Scheitern stehen. Dabrowski wollte professioneller Fotograf werden, doch er wurde an der Filmhochschule in Łódź für ein Studium der Fotografie abgelehnt. Der Fotograf ist in Teilen farbenblind. Er hat Schwierigkeiten, ein paar Blau-, Grün- und Grau-Töne zu erkennen. Deswegen durfte er nicht an der Hochschule studieren. Also entschied sich Dabrowski für die zweitbeste Wahl: Soziologie und später für ein paralleles Studium der Fotografie in Tschechien, für das er immer wieder von Polen nach Tschechien pendelte. „Ich schaue also auch als Soziologe und nicht nur als Fotograf auf diese Welt“, sagt Dabrowski.


Auf der Fashion Week dokumentierte er daher nicht nur die Trends, die gerade sichtbar sind, sondern auch das Chaos und die sozialen Phänomene, die abseits der Shows passieren. In dieser Saison hielt Dabrowski fest, wie Massen an TikTok-Fans vor den Shows auf ihre Idole warteten, wo vorher noch Fans von Schauspielern und Musikern standen: „Diese Kids waren anders als die Fans von Rihanna oder A$AP Rocky“, sagt Dabrowski. Zur Modefotografie ist Dabrowski fast zufällig gekommen. Das Nachrichtenmagazin, für das er in Polen als Dokumentarfotograf arbeitete, saß im gleichen Haus wie eines der Hochglanzmagazine aus Polen, die über Kunst und Mode berichteten. Die Redakteur:innen wurden auf Dabrowski aufmerksam und er begann Fotos für sie zu schießen. Seinen Durchbruch hatte er dann in Mailand mit einer Fotostrecke für Vogue Young Talents und Prada, die anschließend in einem Prada-Store ausgestellt wurde.
Auch wenn Kuba Dabrowski nun seit Jahrzehnten im Beruf ist, Kampagnen für große Marken fotografiert hat, etliche Länder bereist und Menschen vor der Kamera hatte, das Motiv, dass ihn nicht loszulassen scheint, ist seine Heimat. Immer noch drucken Magazine seine Schwarz-Weiß-Bilder aus den 90ern und 00er-Jahren in Polen. Kuba Dabrowski lebt mittlerweile in Berlin und reist regelmäßig in seine Heimat zurück. „Polen wurde noch nicht oft genug fotografiert“, erklärt er. Es brauche mehr Fotos von Polen, die das Land zeigen, wie es ist – nicht wie es sein will. Keine Bilder, auf denen die Häuserfassaden zum Verwechseln ähnlich sind mit Städten wie Kopenhagen oder Paris, sondern die Ecken von Polen, die bisher kaum gezeigt wurden. Kuba Dabrowski könnte für Polen sein, was Bruce Springsteen für Nebraska war. Weil er hat, was er hat: einen zerschneidend scharfen Blick auf ein Land und eine Gesellschaft, über die er mitreißend schöne Geschichten erzählen kann, die Sehnsucht wecken.



Kuba Dabrowski photographed by Jonathan Daniel Pryce.
Text: Carmen Maiwald
Photographer: Kuba Dabrowski
Click here for the last episode of Kuba’s column “Antropologia i obserwacja”