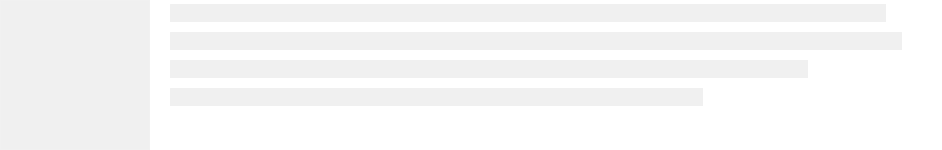ACHTUNG Nr. 47

Left: Diane & Madeleine in LOEWE photographed by Anna and Maria Ritsch. Right: Kajally in ZEGNA; Soheib in PRADA and Emil in jacket and pants LGN LOUIS GABRIEL NOUCHI and tank top CELINE HOMME photographed by Spyros Rennt
”Family: The New Generation“
Heute ist ja irgendwie alles Familie. Die besten Freund:innen, die workmates im Büro, selbst ganze Dekaden im Berliner Nachtleben und mit ihr die Disco wurden schon zu einer „virtuellen Familie“, „einer sozialen Architektur“ in der es „egal [war], wie du aussahst, was du anhattest, wie viel Kohle du hast“ (Der Klang der Familie, Sven von Thülen, Felix Denk). Das klingt fast nach Familien-Utopie, nach losen Verbindungen als Glücksgemeinschaft, die einem vor allem eines verspricht: Zusammen sind wir weniger allein.
Das ist in erster Linie ja nicht schlecht. Verspricht die Wahlfamilie doch schon aus dem Grund, dass man sich völlig frei selbst aussuchen kann, wer einem zum:r Freund:in wird und wer nicht. Bei Familie ist das anders. Das ist ein unordentlicher Haufen an Leuten mit irritierendem Interior-Geschmack und seltsam politischen Ansichten, mit denen man normalerweise nicht stundenlang in der Küche sitzt und darüber diskutiert, ob Beyoncés neues Album Cowboy Carter nun schlichtweg genial, weil „politische Message und so“ oder einfach nur schlechte Musik ist.
Familie, das sind oft eher immer wiederkehrende Streitthemen, sarkastische Seitenhiebe, das große Schweigen am Familientisch, das sind Weihnachtsabende, die man entspannter allein zu Hause verbracht hätte. Der Ort, der für manche das größte Glück, für andere die Gewissheit ist, dieses Irrenhaus ist mein Zuhause. Kaum jemand hat wohl diese fragile Gemeinschaft beklemmend schöner beschrieben als der amerikanische Dramatiker Tracy Letts. „Meine Frau nimmt Tabletten, ich trinke. Das ist die Übereinkunft“, monologisiert der Hausherr dort in Eine Familie gleich am Anfang über das Zusammenleben in jenem Bündnis, aus dem sich manchmal eben nicht so einfach aussteigen lässt.
Familie, das ist kein Freiwilligenverein. Keine kuratierte Ansammlung von Menschen. Kein Friede-Freude-Eierkuchen. Und wann man ehrlich ist, wächst man auch nicht an der Diskussion mit der besten Freundin über Beyoncé oder ob sie nun das mega-süße Foto auf Insta posten soll oder nicht. Sondern an Menschen, die einen fordern, aufreiben, zur Weißglut treiben. Nur so lernt man sich selbst zu hinterfragen, für sich einzustehen. Dass man den Vintage-Yamamoto-Pullover jetzt trotzdem zum 80. Geburtstag von Opa trägt, obwohl er aussieht wie ein mottenzerfressenes Zelt mit Löchern. Dass man sich ein Leben in der gesunden Luft der Kleinstadt nicht vorstellen kann, auch wenn es so viel besser für die Enkelkinder wäre. Dass man nicht in die Moschee gehen will, nur weil es der Vater tut.

Albrecht Schuch in BRIONI and Karoline Schuch in NANUSHKA photographed by Julia von der Heide and styled by Markus Ebner

Selma in CELINE from the “The Women of Sarajevo” story photographed by Claudia Grassl and styled by Mirjana Hecht

Dhyani and Padani Kandagama in CHANEL Haute Couture S/S 2024 from the “Traumtänzerinnen” story photographed by Julia von der Heide and styled by Markus Ebner
Übrigens, emotionale Nähe in Freundschaften, die über das reine „Wir treffen uns mal zum Kaffee“ hinausgeht, entsteht meist dort, wo eines nicht ist: die eigentliche Familie. In Zeiten großer Einsamkeit und vor allem dann, wenn Familie mit Schmerz, Enttäuschung und schlechten Erfahrungen verbunden ist. Unter Freund:innen, bei denen das langfristig „Füreinander verantwortlich sein“, das Mitfühlen, das „Meine Freund:innen sind meine Familie“ eben kein leerer Pathos ist, der allzu oft in „heute ist eher schlecht“ endet.
Wie sich familiäre Konstellationen festigen, gemeinsam entwickeln oder auseinanderdriften und wie Menschen Vertrauensverhältnisse bilden, aus denen starke Gemeinschaften entstehen, ist aber keine ausschließlich persönliche Frage. Sie betrifft vielmehr uns alle. Sucht man in Stockbildern oder dem Internet nach dem Schlagwort „Familie“, ergießt sich nämlich vor einem immer noch eine Flut an Fotos fröhlich in die Kamera grinsender Vater-Mutter-Kind-Menschen. Der Begriff der Familie, muss man leider sagen, hat vor allem in Deutschland schon immer die Sehnsucht nach einem bestimmten Ideal beschrieben: einer homogenen, christlichen, weißen Gesellschaft, in der Männer das Sagen haben, Frauen sich vor allem ums Kinderkriegen kümmern. Dafür müsste man nicht einmal das aktuelle Parteiprogramm der AfD lesen, in dem es nur so wimmelt von Themen wie „traditionelle Geschlechterrollen“, „Vater, Mutter, Kind“, „die Familie als wertegebende gesellschaftliche Keimzelle“.
Die Realität aus zwei Müttern, drei Stiefgeschwistern, dem WG-Mitbewohner, der zum Ersatzopa wird, sieht längst diverser aus. Muss sie auch. Denn wie das Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock im Februar in einer Studie bekanntgegeben hat, wird die Zahl der Verwandten, die ein Mensch hat, in naher Zukunft voraussichtlich um mehr als 35 Prozent abnehmen. Was in Zukunft also bedeutet, weniger Zeit mit der nervigen Verwandtschaft, dafür mehr Happy Family.

Soheib in Top CHRISTINA SEEWALD; Shorts PRADA. Sebit in Top MSGM; Shorts CHRISTOPH RUMPF; Shoes DSQUARED2. Emil in BURBERRY. Kajally in Top and shorts FERRAGAMO; Shoes LOEWE. Marlon in Top MARTIN NIKLAS WIESER; Shorts VALENTINO; Shoes DOLCE & GABBANA from the “Wahlfamilie” story photographed by Spyros Rennt and styled by Alexander Rottenmanner

José, Eliza and Lola Kallmann in LOUIS VUITTON from the “The Kallmann Family” story photographed by Maximilian Heimlich and styled by Mirjana Hecht

Diane in Dress FERRAGAMO; Face accessory MONCOMBLE. Madeleine in Tank top DRIES VAN NOTEN; Blouse and pants LOUIS VUITTON; Face accessory MONCOMBLE from the “Familienbande” story photographed by Anna and Maria Ritsch and styled by Johanna Bouvier
Apropos, dass es auch in der Mode immer mehr glückliche Fügungen gibt, dafür sorgt eine Frau: Alice Bouleau, die Kupplerin der Mode. Unsere Chefreporterin Silke Wichert hat sie getroffen und erfahren, wann es zwischen einem Modehaus und einer:m Designer:in funkt und warum immer noch oder besser, schon wieder, so wenig Frauen auf den Chefposten sitzen. Gabriele Strehle war so eine Frau und das Unternehmen ihrer Familie, Strenesse, wurde einst als Aushängeschild der deutschen Mode gehandelt. ACHTUNG-Autorin Carmen Maiwald ist der Frage nachgegangen: Was hat das Ganze nur so ruiniert? War es am Ende doch die eigene Familie? Strenesse erfährt übrigens gerade eine wundersame Wiederbelebung. Hat allerdings nichts mehr mit der Familie Strehle zu tun. Im Mai 2024 soll man die erste Kollektion bewundern können. Was man daraus lernen kann? Selbst die schwersten Fälle sind nicht ganz ohne Hoffnung. Das gilt bestenfalls auch für die eigene Familie. – NICOLE URBSCHAT


After our 20-year-anniversary-issue for which we delved into memories past and worked closely with the people who have accompanied us along the way, the time has come to foster a new roster of ACHTUNG-family members: Writers, stylists, photographers. A fresh set of talents and a big focus on delivering great journalism has led to one of the thickest ACHTUNGs to date. Among them is a great investigative piece by Carmen Maiwald about the fall of the Strenesse empire and why family-run businesses carry a big risk of foundering. We reinstated some old columns, came up with new ones and of course brought back the classics. Here’s a preview of all of it:

STOFFSAMMLUNG: Isabel Marant, Julie Pelipas: Bettter, Chemena Kamali, John Galliano, Hoodies für die Welt, Mächtiger Stoff, Heilbrunner & Söhne, It’s Anna’s World. Illustrationen: Sarah von der Heide

IM AUGENBLICK: Die Kupplerin der Mode. Sterling-Headhunter Alice Bouleau im Gespräch mit Silke Wichert. Foto: Kaj Lehner

MADE IN GERMANY: Maximilian Bittner, CEO Vestiaire Collective. Text: Silke Wichert. Foto: Kuba Dabrowski

OSTBLICK: Bevza. Text: Nicole Urbschat. Foto: Kaj Lehner

MODEHAUS: Arbesser x Wittmann. Text: Valerie Präkelt. Foto: Anna Breit

LEIBGERICHT: Martina Tiefenthaler. Text: Gabriel Proedl. Foto: Martina Tiefenthaler

DESIGNER PROFIL: ioannes. Text: Hannah Heitmüller. Foto und Model: Iga Drobisz

HAUSBESUCH: Hanne Plein-Dieth. Text: Silke Wichert. Foto: Martina Borsche

ZUGABE: Fendi bei Mario. Foto: Martina Borsche