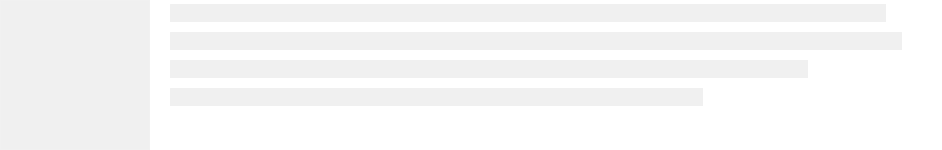Jeder Künstler ist auch Mensch
„In irgendeine Schublade müssen sie einen ja stecken.“
October 24, 2014

Auf niemanden passt dieses Kippenberger-Zitat wohl mehr als auf Daniel Josefsohn. Ein Gespräch mit dem Chef-Raubauken der deutschen Fotografie.
Dreimal hintereinander klingelt das Telefon. Ich müsse jetzt bitte sofort vorbeikommen, sagt Daniel Josefsohn, anders ginge es nicht. Jawohl! Aufgelegt. Da ist er also immer noch, denke ich, jener testosteröse Lebensdrang, den ich ihm klammheimlich nicht erst seit 2003 unterstelle, als wir uns das erste Mal trafen. Schon damals galt Josefsohn als Fotograf, in dessen Gegenwart man sich immer ein wenig mitgerissen fühlte, weggerissen aus der eigenen beschaulichen Welt, hinein ins Jetzt, in den Augenblick, so wie auch an jenem Samstag Morgen als wir uns für ein Interview zu seinem ersten Buch verabreden. Authentisch mögen Kritiker das nennen, irre, manche Redakteure, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Wichtig war dies eh nie. Denn egal, ob Josefsohn Porträts, Werbung oder Modestrecken fotografierte, seine Bilder sind vor allem eins: unverwechselbar ehrlich.
Bilder, die stets die Wirklichkeit zeigen und den Riss, der durch sie hindurch geht.
Voller Gegenwart, Leben, Humor und Herz. Wie er selbst. Seine jüdischen Großeltern zogen nach dem Holocaust nach Florida. Sein Vater nach Hamburg. Geboren ist Josefsohn dort. Aufgewachsen zwischen Hippiemusik und Glamrock-Sounds im Big Apple und Crazy Horse, jenen legendären Clubs, die Anfang der Siebziger Jahre seinem Vater gehörten. Das hinterlässt Spuren. Die Großeltern holen ihn als Teenager in die USA. Dort wird er Skater, versucht sich als Profi, bis ihm ein Bänderriss den Lebensmittelpunkt unter den Füßen wegreisst. Zurück in Hamburg kommen erst die Drogen, dann rettet ihn die Fotografie.

David Baum (Berlin Grunewald 2001).
Mit seiner MTV-Kampagne „Miststück“ wird er in den Neunzigern bekannt – ironisch, popkulturgesättigt, irgendwie verkifft entspannt. Was für eine Generation zu einem Sinnbild des Jahrzehnts wird, wird für Josefsohn real. Nicht nur als ästhetisches Leitmotiv. Den Zynismus und den saturierten Irrsinn der Medien- und Konsumkultur lebt er, mehr als rasant, anstatt ihn nur zu erleben. 2012 erfolgt der erzwungene Einschnitt durch einen Schlaganfall, sein Leben davor und danach veröffentlicht er seitdem mit seiner Lebensgefährtin Karin Müller unter dem Titel „Am Leben“ im ZEITmagazin.
Dass bei Josefsohn alles nur Provokation, ein zynischer Witz sei, wie seine Kritiker seit je moniert haben, ist vor diesem Hintergrund so zutreffend wie unpräzise. Weiss man, dass die Ironie, der Witz ein schmerzstillendes Mittel für die Seele ist, dass er Erleichterung verschafft, dass er wie der Traum eine versteckte Wunscherfüllung darstellt, so wird Josefsohn nicht nur in seiner sarkastischen Ästhetik zu einem Inbegriff des Jahrzehnts, sondern auch in seinem künstlerischen Lebenslauf. Keine Werk- ohne Biografieanalyse. Schließlich galt schon immer: Worüber man nicht weinen kann, darüber soll man lachen.
Herr Josefsohn, was ist ein unkorrektes Bild?
Ein unkorrektes Bild? Verstehe ich nicht.
Viele beschreiben ihre Bilder doch als unkorrekt. Das ist es zumindest, was am Ende immer dasteht: Josefsohn, der Fotograf, der draufhält, der aneckt, der provoziert.
Da müsste man ja erst einmal definieren, was unkorrekt ist. Unkorrekt wäre für mich beispielsweise das Bild eines IS-Soldaten, wie er Menschen enthauptet. So ein Bild habe ich nicht. Klaus Honnef, der einen wunderbaren Text für meine gerade erschienene Monografie geschrieben hat, spricht von meinen „unkorrekten Bildern“, weil sie sich für ihn von der pseudo-political-correctness im Kunstbetrieb absetzen.
Stattdessen aber ein Bild des Papstes zwischen den gespreizten Beinen einer Frau mit dem Aufdruck „S.O.S. Kinderdorf“. Ging es Ihnen dabei nicht um die Provokation?
Nein. Was soll ich denn da provozieren? Provokant ist das, was real passiert ist. Und ich habe die Situation einfach nur „inszeniert“. Ich habe ja nicht live einen Missbrauch fotografiert. Die Situation ist ja längst da, das ist die Scheiße. Ich habe sie nur visualisiert und bildlich zugespitzt, in der Form, wie ich es kann.
Das scheint manchen Leuten schon auszureichen.
In irgendeine Schublade müssen sie einen ja stecken. Das brauchen die Leute. Du bist Modefotograf, Du bist Still-Life-Fotograf, Du machst Reportage. Du hast den Turner-Prize gewonnen. Schubladen. Es geht immer um die Bezeichnung, mit der die Leute denken, Dich sofort einordnen zu können.
Dann anders gefragt, was wäre denn ihre liebste Schublade?
Seit der MTV-Kampagne, „Willkommen zu Hause, Miststück“, war ich immer der Bauzaun. Wolfgang Tillmans war Galerie. Jürgen Teller war High-Fashion. Ich, der Bauzaun. Nur ein kleines Beispiel, ich habe mich sehr dafür eingesetzt, dass mein Buch 29,80 und nicht etwa 49,80 Euro kostet, damit auch die Kids es kaufen, damit es verfügbar ist. 29,80 – das ist das unterste Level beim Hantje Cantz-Verlag. Ich wollte nicht 100-Euro-Bruce-Weber. Das bin ich nicht.

Anus (2008).
Wer heute in ein Lifestyle-Magazine blickt, sieht aber meist doch den Bruce-Weber-Typ. Glatte, korrekte, gut aussehende Menschen. Fotografiert in einem global austauschbaren Durchschnittslook. Wo ist der Humor geblieben – eine Erklärung?
Diese ganzen Hefte sind natürlich wahnsinnig langweilig. Wenn soll das inspirieren? Mich nicht. Es werden einfach kaum mehr Geschichten erzählt. Und weil heute so gar kein Verve, keine Idee, kein Witz mehr dabei ist, ist es einfach nur ernst. Das macht es zu einfach, zu austauschbar. Dann sieht eben alles gleich aus.
Vielleicht sind die Zeiten zu ernst?
Nein, der Grund ist der, dass das ganze Business so eine große Blase geworden ist. Bei einem Shooting mit 30 Leuten, wie will man denn da noch was wagen? Es geht nicht mehr um Kreativität, sondern darum ein Teil des Kuchens zu sein. Heute sind die Menschen ja schon glücklich, wenn sie bei der „Vogue“ arbeiten oder in der Werbung. Und diese Menschen replizieren sich nur noch selbst. Das ist in einziger Klüngel, der die Standards setzt, an denen sich alle anderen orientieren sollen. Es kann doch nicht sein, dass das der Standard ist. Das soll es gewesen sein?
Was macht denn für Sie gute Modefotografie aus?
Gute Modefotografie, das ist sicher Eigenständigkeit. Und es müssen echte Fotos sein. Wenn Steven Meisel heutzutage eine Geschichte macht, dann ist die perfekt, aber irgendwie auch wahnsinnig langweilig. Das überrascht nicht. Helmut Newton hingegen hat mit jedem Bild überrascht, die Bilder waren echt, mehr als nur Fashion.
Heutzutage gilt vielleicht nur noch eine Botschaft und die lautet, leicht konsumierbar. Zweideutige Aussagen, die über „Kauf mich“ hinausgehen, sind da fehl am Platz.
Das glaube ich immer noch nicht. Wenn die Idee gut ist, ein Foto ehrlich ist, nicht gestellt, auf das Wesentliche reduziert, dann geht alles. Kippenberger hat mal gesagt: „Pack nur so viel auf ein Foto, wie drauf passt“, das gilt noch heute.

Selbstporträt: Am Arsch, Herr Kippenberger (2013).
Es gibt also auch bei Ihnen eine Idee, ein Konzept hinter dem Bild. Doch nicht „Zack-Zack-Bumm“ aus dem Bauch heraus, wie man es Ihnen gerne unterstellt.
Ich gehe ja nicht rum und mache Fotos. Ich fotografiere aber auch nicht die Jeans auf dem Hocker. Ich mache das, was mir Spass macht und dann bekomme ich da auch schon mein Bild raus. Das sind die Art von Fotos, die, wenn Du Glück hast, dann zu solchen werden, wie das des israelischen Soldaten mit dem Louis Vuitton Cap unter dem Stahlhelm. Die im Nachhinein zu einem Symbol werden.
Gibt es eigentlich ein Lieblingsbild in dem Buch?
Ich mag alle irgendwie gern, aber am liebsten mag ich jene, wo der Name dem Foto noch einmal extra Größe gibt. „Lieber Helmut, Lieber George, ich wollte auch mal mit der Eisenbahn spielen“ oder „Television ruined my life“. Dieses Foto war für mich völliger Schrott, bevor ich diesen Namen hatte. Manchmal macht der Titel aus einem Foto erst ein Bild.
Und somit das Bild zur Kunst. Ist diese für Sie mittlerweile zum Rückzugsort geworden?
Sie ist eher Zielgebiet als Rückzugsort. Rückzug wäre für mich das falsche Wort. Aber ja, Kunst ist geil. Vor allem in Museen, kulturellen Instanzen, im Gegensatz zu Galerien. Die sind doch irgendwie wie Comme des Garcons in Bildern, oder? Alles käuflich. Kunst als Schublade? Nehme ich. Allein schon deswegen weil alle Museen barrierefrei sind. Kann ich also jederzeit rein. Jackpot!
“OK DJ” die erste Monografie von Daniel Josefsohn ist erschienen bei Hantje Cantz. Mit Texten von Nadine Barth und Klaus Honnef. Gestaltet von Mirko Bosche und Tania Parovic.